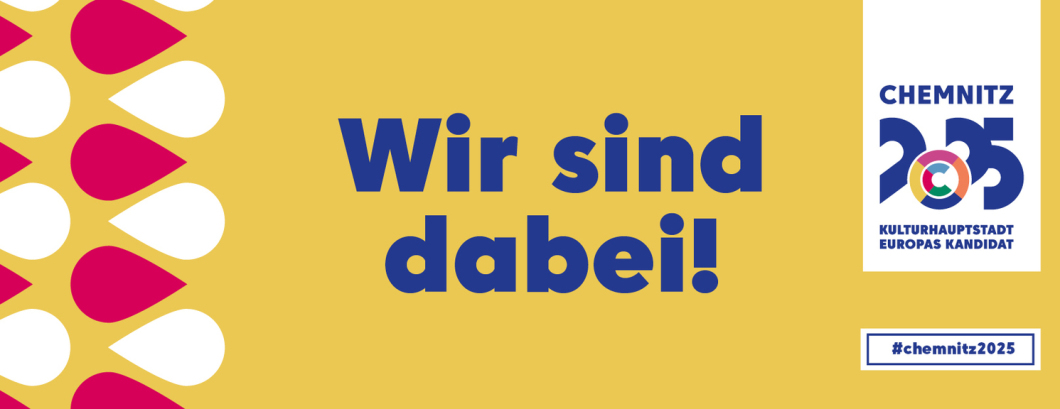Thema LiteraTOUR:
Im Jahr 2011 wurden vom Institut für Anglistik und Amerikanistik der TU-Chemnitz bereits mehrmals literarische Stadtspaziergänge veranstaltet. Mittlerweile wurden das Stefan-Heym-Forum mit Arbeitsbibliothek im „DAStietz“ und die Dauerausstellung zum Schocken-Verlag und den sächs. Wiegendrucken im „SMAC – Staatl. Museum für Architektur Chemnitz“ als etablierte Museen in der Chemnitzer Innenstadt zur kulturellen Bildung eingerichtet.
Ein Teil der neuen Tour steht im Zeichen der Umgestaltung im Zuge des Wiederaufbaus der Innenstadt nach der Kriegszerstörung. So wird den Gästen und Besuchenden gezeigt, wie sehr sich Chemnitz medial-kulturell und zugleich in ihrem Angesicht verändert hat - und schafft eine Entdeckungsroute für die Chemnitzer Literaturgeschichte. Es ist ein Angebot, mit literarisch-musischen Texten der Touren-Stopps in Kontakt zu treten und diese als Basis weiterer individueller Entdeckungen in der Stadt zu nutzen.
Credo ist: Lernorte / Erinnerungsorte und Aktionsorte sowie City-Sights miteinander zu verbinden!
Ausblick: neue Horizonte für eine Zukunft weisende touristische Anbindung schaffen, auf Pfaden der Sprachförderung Mitteldeutschlands. Zur weiteren Orientierung finden Sie INFO-Stelen.
Termine von Touren (diverse Anbieter, eigene Touren rot markiert) :
15.03.2025 ChemNetz Stadtkarten-Release 16 Uhr, Tour Ostmoderne/Rotes Chtz. (ab Marx / SMAC)
OSTERzeit Ostereier-Wanderweg zw. Auerswalde (Gemeinde Lichtenau, Zugang über C14 Bhf.
Oberlichtenau) > Rundweg Richtung Garnsdorf und zurück
10.05.2025 LiteraTOUR zum Gedenktag der Bücherverbrennungen des 3.Reichs ca. 15 Uhr ab Tietz
14.05.2025 Tag des Wanderns - Exkurs zu den Liederwanderwegen Niederwiesa (AbendTOUR 18:30
ab Bf. Braunsdorf-Lichtenwalde > Alte Mühle > Waldkapelle > Zapfenbach...
06.07.2025 FerienExkurs "Engel- & Bergmann-Wege" Pfaffenhain > Lugau > Oelsnitz > Gersdorf, s.u.
19.07.2025 Chemnitztal-RadTOUR m. City-Bahn von Burgstädt ins Schweizerthal zum Parksommer
12.09.2025 LiteraTOUR zu "Chemnitz liest Heym" (im Rahmen d. Interkultur. Woche) 15 Uhr SMAC
17./24./25./27.9./25.10./29.11./12.12. geführte TourenGruppen teils m. Bus entlang Industrieroute Chtz.
je Samstags Free-Walking-Touren Chemnitz 10:30 (dt.) & 11 Uhr (eng.) ab HartmannFabrik - 90 min.
Jahr 2025 Ökumenisches Samstagspilgern je 9 Uhr (Treffpunkte unter www.kulturkirche2025.de)
30.09.2025 KulTOUR-Besuch der dt.-sprach. Volksbühnen z. neuen Bergmanns-Oper "Rummelplatz"
03.10.2025 Erkundungstour "Auf Bergmannspfaden" z. Wismut-Schacht371 Hartenstein> Wolkenstein
20.-25.Okt. Musikalische Pilgerreise "Klang & Weg", z.B. 25.10. 10-18 Uhr Kirche Lugau üb. Gersdorf
02.11.2025 Land Art Photography WorkOut im Zschopautal von Sachsenburg zum Wehr Schönborn, mit der Handfähre "Anna" zum Erbstollen (www.schaubergwerk.de) zurück 12-18 Uhr
05.11.2025 LeseTOUR nach Döbeln zu Treibhaus e.V., ein DDR-Abend m. Aron Boks "Starkstromzeit"
15.11.2025 Kreativ-Tour zum Höhenwanderweg Chemnitzer Süden ab Einsiedel 10-13 Uhr
Advent ´25 Krippen- u. Pyramidenweg Greifenstein-Region (ganz Amtsberg OT Weißbach)
Ausblick:
Sept. 2026 Eurorando Krusne hory / Erzgebirge m. ca. 50 Wanderrouten, Bozi Dar & Oberwiesenthal
Alle Chemnitzer City-TOURen im Überblick:
KurzTOUR 500 Jahre Stadtgeschichte auf 500m Rathaus> St.Jakobi> Hedwighof> Markthalle> Stadthalle> Marx (1h)
erweiterte KurzTOUR (1,5h) CITY: Hartmannfabrik > Pfortensteg > Rathaus > Tietz-Kulturhaus > Mikwe > SMAC > Marx-"Nischl" > ggf.+ Stadthalle > + Roter Turm > + Pinguine
gemütliche TOURen (2h): Roter Turm > Stadthalle > Marx-Kopf > Theaterplatz > TU-Biblioth.> Brühl > Stadtbad > Schloßteich-Areal > Hartmann-Fabrik > Markthalle > St.Jakobi > Markt > Tietz (Versteinerter Wald)
oder:
Theaterplatz > Straße d. Nationen (m. Tiefstraße) > Marx > Roter Turm > Saxonia-Brunnen > Tietz > Rathaus > St. Jakobi > SchmidtBank-Passage > Hartmann-Fabrik
Chemnitzer Pitaval DIE Krimi-TOUR: Hartmannfabrik > Pfortensteg > St.Jakobi/Rathaus > Marx > SMAC > Hbf. > "Bazillenröhre" > Alte Gießerei > Sonnenberg > Park der OdF > Mikwe > Kulturhaus Tietz
OSTmoderne-TOUR: Start Omnibusbahnhof > Brühl > Fritz-Heckert-Haus > Marx-Monument > Straße d. Nationen > Reitbahnviertel/Tietz > [Erweiterung: Auepark > Rosenhof]
Chemnitzer City-Interventionsflächen im Kulturhauptstadtjahr, Tour ab Theaterplatz > Marx.Kopf > SMAC > Park der Opfer d. Faschismus > Mikwe-Ausstellung > Tietz > Aue & Falkeplatz > Markthalle > Stadthalle/ Roter Turm > Theaterpl.
Regen-TOURen (überdacht bzw. teilüberdacht): Hartmannfabrik > Schmidtbank-Passage > (ÖPNV 21 od. 32) > Tietz-Kulturkaufhaus > Zentralhaltestelle > Roter Turm > Straße der Nationen > Kunstsammlungen > (ÖPNV) >
ggf. Erweiterung um Rathaus > St.Jakobi
Kunst-Meile (ca. 2h): SMAC > Park d.Opfer d.Faschismus > Kulturkaufhaus Tietz > Viadukt > Mus.Gunzenhauser > Hartmann-Fabrik > Janssen-Park > Schillingsche Fig./Schloßteich > Schloßberg-Museum
SkulpTOUR Wege (ca. 2h): Rathaus > (Höfe der Inneren Klosterstr.) > Stadthallenpark > SMAC / Lobgedichte > Park der O.d.F. > Versteinerter Wald > Park an der Aue > Falkeplatz > Hartmannfabrik > Schloßteich
Schlaglicht City-Quartiere (Johannis-Karree): SMAC > Bunte Treppen, Friedensplatz > Simmel-Kaufhaus > Mikwe > Allee des Lichts > Park der O.d.F. > Flächendenkmal Reitbahnviertel > Tietz (Versteinerter Wald)
Lost Places-Tour (mit Fahrrad oder E-Roller): Start am Garagen-Campus > Zwickauer Str. > Bernsdorfer Str. > Annaberger Str. > Limbacher Str.
Bus-Touren (0,5-2h) aus der City Richtung: Tietz-Kulturhaus > (Park der O.d.F.) > Viadukt am Wirkbau > Villa Esche > Wanderer-Werke > Garagen-Campus "#3000Garagen", Zwischen-STOP mgl. > Kaßberg > Stadtbad/BRÜHL > Schloßteich > Oper > Marx-Monument > Roter Turm > Hartmann-Fabrik an der Markthalle
LiteraTOUR: ...siehe ff. unten
Durchführungsorte der City-Touren auf literarischen Pfaden 2025 entlang folgender Orte..
Tietz Das 1913 eröffnete nach 10-jähr. Bauzeit Warenhaus war damals das „größte und vornehmste Geschäftshaus Sachsens“, Architekt: Wilhelm Kreis (u.a. Hygienemuseum DD), Geschäftsführer war Hermann Fürstenheim, 8.11.1938 im Zuge der Reichspogromnacht geschlossen. Nach dem Krieg Erzgebirgswarenhaus ERWA, dann Konsum-Warenhaus, ab 1963 nach 5-jähr. Sanierung HO Zentrum-Warenhaus als modernstes der DDR, 2004 „Kulturkaufhaus DAStietz“ mit Bibliothek, Volkshochschule, Neue Sächs. Galerie und Naturkundemuseum. Seit Ende 2020 beherbegt es die Stefan Heym-Arbeitsbibliothek. In der Ausleihe der Sdtbibliothek sind auch andere berühmte Chemnitzer Literaten, wie Werner Bräunig, Lothar-Günther Buchheim (Das Boot), Michael Degen, Kerstin Hensel, Kirsten Fuchs, Peter Härtling (Kinderbücher), Angela Krauß, Erich Loest, Dieter Noll, Rolf Schneider, Ingeburg Siebenstädt alias Tom Wittgen (Krimis), Emil Rosenow, Kurt Barthel alias Kuba, Matthias Biskupek, Werner Légere, Günter Saalmann u.a.
Das Kulturkaufhaus Tietz bietet vielfältige Möglichkeiten, sich spielerisch und entdeckend mit den Themen Sprache und Schrift zu beschäftigen, bspw. mit pädagogischen Angeboten der Neuen Sächsischen Galerie des Kunsthütte e.V. - die Begrünung des Vorplatzes ist auch ein Kunstwerk, "Lustgarten" genannt, dieses Aufbrechen des Stadtpflasters wie bei einem Vulkan mittels Porphyrgestein vom Zeisigwald und dem Megaviulkan vor 290 Mio. Jahren . Oder ist es die Rückeroberung der Natur.
Nicht zuletzt die Leseförderung steht mit der gut ausgestatteten Stadtbibliothek im Mittelpunkt der Kulturarbeit. Mit der kostenfrei zugänglichen Stefan-Heym-Ausstellung auf Bibliotheksebene bietet das Haus einen einzigartigen Sammlungsort und ist damit bestens als Ausgangspunkt für die LiteraTOUR geeignet.
Blick zur Zentralhaltestelle (ehem. Bretturm, heute: Chemnitz-Plaza) – FUN-FACT: hier saß Karl May 6 Wochen lang ein, wohl wegen eines Missverständnisses über die Leihdauer einer Taschenuhr eines Lehrerkollegen - ob die Karenzzeit ihn zu mehr Fantasie im Geiste anregte und nur so Winnetou erschaffen werden konnte, ist anzunehmen!
Moritzhof: [Geschichte der Bücherverbrennungen in Chemnitz] + Plastik Alltags-Engel von Silke Rehberg (7.12.1997)
Zum Gesamtkunstwerk gehören mehrere Mosaikbilder, die sich am Boden auf dem Platz vor dem Moritzhof und im Innenhof des Gebäudes befinden. Sie werden Weggeworfenes genannt und stellen u.a. Bananenschale, Zigarettenstummel und zerbrochenes Glas dar. FUN-FACTs: der Engel wurde in 2013 für ein paar Stunden zum kollektiven Kunstwerk, da ihm via Flaschezug von einem Unbekannten ein Fahrrad untergeseilt wurde u. ein T-Shirt an..
und ein weiteres Kunstwerk (ca. 3x2 m. große graue Glasscheibe mit Digitalanzeige (wieviele Tage seit der Kriegszerstörung am 5.3.1945 vergangen sind) als Mahnmal im Posthof wurd leider mehrmals angefahren und (teil-)zerstört und nun eingelagert.
Blick zur Alten Hauptpost, Bretgasse, Frontal-Gebäude von 1859 zerstört, hinterer Anbau im /Historismus/Jugendstil v. 1909/10 hingegen erhalten geblieben
Blick zum Viadukt: 1858 als Steinbrücke erbaut. 1909 ist der „liegende Eiffelturm“ Fachwerkbrücke aus 7300 t Stahl u. 2,5 Mio. Nieten fertiggestellt (17m B / 275m L) für 4 Gleise, seit 1945 ist die sog. Beckerbrücke nur noch zweigleisig...
Blick zum WIRKBAU Ein kleines Stück Italien in Chemnitz: Der berühmte freistehende Glockenturm Campanile in der Lagunenstadt Venedig war das architektonische Vorbild, als der renommierte Architekt Erich Basarke 1927 den 63 m hohen Uhrenturm (Uhr 3,5 m TonB-Glocke 4,6 t pro voller h / TonF-Glocke 1,4 t viertelstdl.) im Stil des Art deco für Schubert & Salzer inkl. Einem 30 m hohen Aufzug erbaute > Funktionalität & Ästhetik !! Salzer übernahm 1892 das 1883 in einem innerstädt. Hinterhof gegr. Unternehmen des Schubert. Fortan: Schubert & Salzer Wirkwarenmaschinenbau, ab 1904 allg. als Maschinenfabrik AG geführt, da Petinet-Cottonmaschinen, Strick- Spinnerei-, Flach- & Rundstrickmasch. 1919 größte Chtz. Maschinenfabrik m. 5500 Arbeitern, auch Gießerei (heute I-Mus.) an Zwickauer Str. u. 1938 die DESPAG (Ingolstädte Dt. Spinnereima.AG) wurden übernommen, nach Krieg VEB, heute auf 45.000 qm über 50 Firmen, inkl. Kultclub "Atomino" und 1500 qm parkähnlicher Dachterrasse.
Blick auf das Kulturzentrum "Weltecho", ehem. Kammer der Technik (DDR) und vor dem Krieg: "Chemnitzer Neueste Nachrichten" seit 1889 (sozialdemokrat. Tagespresse, um 1900 zweitgrößte Zeitung Sachsens), 1910 70.000 Ex.-Auflage, seit 1919 Amtsblatt der Behörden, 1941 Produktionseinstell. u. Übernahme v. "Allg. Zeitung", ab April 1943 nur noch das Parteiblatt der NSDAP ersch., nach 1945 wurde der Bau nicht mehr m. Jugendstildekor verziert. Die Medienkünstler Frank Maibier & Carsten Nicolai haben beim jetzigen Betreiber: Ufer e.V. & Oscar e.V. ihre Heimat.
Blick zum Aue-Park „Sprache am Chemnitz-Fluss“ (literarischer Exkurs ins Erzgebirge, aus dem sich das Wasser speist: die Kitsch-Queen & Kolportage-Schreiberin Hedwig Courths-Mahler gründete 1895-1905 in Chemnitz eine Familie und hatte hier durch die Veröffentlichung von "Scheinehe" im Chemnitzer Tageblatt als Fortsetzungsroman ihr Debüt und Sprungbrett in die Literaturwelt - sie wohnte im Vorort Harthau, ihr Lebenswerk sind über 200 Romane und damit gilt sie als die meistgelesene Autorin Dtl.´s u. steht für die emanzipierte Frau mit solialem Aufstieg ins Bürgertum!)
Der wohl natürlichste und für vor allem jung gebliebene einer der einladendsten Orte der Innenstadt birgt gerade wegen des direkten Erfahrens der Flusslandschaft einmalige Möglichkeiten, die Stadt fragend kennenzulernen, vielleicht als Ausgangspunkt für weitere bestaunenswerte Erkundungen, z.B. ins Schweizertal im Norden der Chemnitzfluss-Auenlandschaft, einzigartig für Deutschland sind die sog. Riesentöpfe der Gesteine im Wasser!!
Deutsche Bank, Falkeplatz: Das konkav gekrümmte Gebäude wurde 1925/26 nach Plänen von Erich Basarke im neoklassizistischen Stil errichtet. 2009 wurde vor dem Gebäude der Chemnitz-Fluss wieder frei gelegt. An seiner Fassade befinden sich 5 Reliefs des Bildhauers Bruno Ziegler, war im Juni 2023 Symbol für eine Aktion der „Letzten Generation“ gg. den Klima-Zertifikate-Handel und sozial ungerechten umweltvermutzenden Aktienhandel.
Blick zum Museum Gunzenhauser, Stollberger Straße 2: Stadtbaurat Fred Otto entwarf das im Stil der Neuen Sachlichkeit 1930 eröffnete Sparkassengebäude, seit 2007 Museum Gunzenhauser.
Blick zum Metropol: 1913 wurde das heute älteste Kino von Chemnitz als Varieté-Theater, Restaurant und Hotel eröffnet und wurde zu einem Publikumsmagnet. Nach dem Krieg erst in den 1980er Jahren restauriert. Heute Fam-kino
Falkeplatz: Skulpturen im Park... "Der Elefant" wurde 1988 von Frank Dittrich für den Spileplatz dort geschaffen, anlässlich des Pioniertreffens eingeweiht. Der Künstler schuf mehrere Elefanten. Die Skulptur Fisch von Rainer-Maria Schubert (1988). In diesem Zusammenhang fertigte Schubert noch eine Schildkröte. Die Holzskulptur (Esche) Jugend im Sozialismus von Johannes Schulze (Sept.1980), Die Holzskulptur Krokodil von Werner Rauschhardt, auch die Skulptur des Künstlers Frank Dittrich „Liebespaar mit Kind / Familie“. Spielhaus u. Sitzende , Beton-Skulpturen von Harald Stephan (1988) befinden sich auch hier.
Der Marktbrunnen von heute Claus-Lutz Gaedicke steht auf dem Falkeplatz (am Hochhaus). Er wurde gegen 1981 vollendet und im Juli 1986 aufgestellt. Er sollte ursprünglich im Oktober 1981 auf dem Fußgängerboulevard hinter dem ehemaligen Flughafengelände aufgestellt werden.
[ mehr zu Skulpturen der Innenstadt... https://www.stadtbibliothek-chemnitz.de/skulpturen/ ]
Rosenhof (ehem. Roßmarkt, 1997/98 umgebaut, arkadenähnlich): hier war Joh. Wolfg. v. Goethe im "Hotel de Saxe" im Herbst 1810 zu Gast und besuchte die Spinnerei der Gebr. Bernhardt in Harthau (damals moderne Manufaktur nach engl. Vorbild m. 400 Arbeitern) // ein zweiter berühmter Universalgelehrter der Stadt ist Georgius Agricola (Georg Bauer 1494-1555), Leiter der Lateinschule, später Bürgermeister, "De Re Metallica" & "Vom Bergkwerck" sind seine Hauptschriften / .
St. Jakobikirche: Stadt- und Marktkirche sowie Pilgerkirche auf dem Sächsisch-Fränkischen Jakobsweg hinterm Rathaus, Innere Klosterstraße. Die hochgotische Hallenkirche entstand zwischen 1350 und 1412 . Herausragend sind der 1504 von Peter Breuer geschaffene Altar sowie der Maßwerkfries im Chorraum. Das bedeutendste Kirchenkunstwerk von St.Jakobi, der Schrein des "Heilige Grabes" ist allerdings im Schloßbergmuseum neben anderer Stadtgeschichte zu bewundern.
Die Plastik Sicile Tor aus Cor-Ten-Stahl von Wolfram Schneider steht vor der Jacobi-Kirche (1999), erstmals während einer Personalausstellung des Künstlers auf dem Theaterplatz zu sehen und steht seit 2001 am jetzigen Standort.
Umspannwerk am Getreidemarkt, jetzt Jugendherberge „eins“-Energie / Blick Richtung St.Jakobi u. "Alte Schmiede"
Pfortensteg Bereits 1470 befand sich hier der Klostermühlenwehrsteig-Ort der Bleichen, Walken, Wehre, Laugen-und Färbehäuser sowie Mühlen. Oberhalb der Holzbrücke auf dem Kaßberg... Exkurs zu den ehem. Standorten der Stadtbibliothek Chemnitz: Theaterstr. > Annaberger Str.> Str.d.Nationen (ehem. Glückauf-Kaufhaus, DDR und zuvor Alte Aktienspinnerei) > DAStietz
KaßbergGewölbe: heute Weinkeller, im Krieg Luftschutzbunker für 10.000 Menschen, vermutl. schon im 15. Jh. Speis- & Bierkeller (der sog. Kühlschrank der Stadt) / zum Falkepl. hin... eher Salzkeller zum Haltbarmachen von Vorräten schon die Zeit zuvor! > auch schiefe Gänge u.a. am Niklasberg, Sonnenbg., Beutenbg./Zeisigwald, Schloßberg > keine typ. Höhler wie in Thüringen unter Gebäuden > hier 18 m. unter Hoher Str., teilverfülltes unerforschtes stets erweit. Gangsystem, 19 versch. große Kellersysteme, Verfall nach neuer Brauordnung Ende des 30jähr. Kriegs 1778 (aber Renaissance wg. zu hohem Grundwasser in den Kellern der ummauerten Stadtfeste ab Industrialisier., 2 Teile sind seit 1999/2003 wieder öffentlich
Erwähnung der darüber erbauten Einrichtungen:
Karl-Schmidt-Rottluff Gymnasium, Hohe Straße 25: Ehemaliges Königliches Gymnasium, 1871/72 von Bezirksbaumeister Hugo Nauck im Stil des Historismus erbaut, Hier legte 1905 der Brücke-Künstler Karl-Schmidt-Rottluff sein Abitur ab. Weitere berühmte Schriftsteller waren die jüdischen Autoren Helmut Flieg alias Stefan Heym und Rudolf Leder alias Stephan Hermlin. Das jetzige "Karl-Schmidt-Rottluff"-Gymnasium mit seinem Haupthaus 1, Hohe Str. 25, steht stellvertretend für Heyms beginnende Karriere als Schriftsteller, denn dort hat er das Gedicht „Exportgeschäft“ getextet und ist wegen dessen Veröffentlichung in der Chemnitzer Presse von der Schule verwiesen worden, floh in Folge dessen nach Berlin, um sein Abitur zu beenden. Sein 'Gang über die Grenze' besiegelte sein Schicksal, das in der Werkausgabe für die humanistische Nachwelt ein Denkmal darstellt. Hinter der Schule befindet sich das ehem. Kaßberg-Gefängnis.
Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis, Kaßbergstraße 16c: Das ehemalige Kaßberg-Gefängnis in Chemnitz ist ein wichtiger Erinnerungsort an DDR-Unrecht und deutsche Teilung. Es diente als Abwicklungsort des Häftlingsfreikaufs durch die DDR, als Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit sowie zuvor der sowjetischen Geheimpolizei NKWD/MGB > Literatur: „Via Knast in den Westen“
Villa Schwalbe: Wohnhaus des Fabrikanten J. S. Schwalbe. Die im Jahre 1811 gegr. Maschinenfabrik etablierte sich ab 1856 in der Chemnitzer Fabrikstr. mit dem Titel „Maschinenfabrik Germania von J.S. Schwalbe & Sohn" > Villa im neoklassizist. Stil m. Geneigtem rechteck. Walmdach. Produziert wurde Reaktoren, Wärmetauscher, Chemieanlagen, Reaktionskolonnen und Lokomotivkessel, Spinn- u. Krempelmasch. Ab da an auch Brauereianlagen (eigene „Einsiedler Brauerei“ 1885 gegr., Turbinen, Wasserräder, Eis- u. Kühlanlagen, Dampfma. & -kessel > ab 1959 Chemieanlagenbau VEB Gemania, 1979 m. Innerstädt. Verwaltungsgenäude Augustusbg. Str. > nach der Wende GmbH m. Vorwiegendem Export in ehem. RGW/GUS-Staaten, jetzt CAC Chemieanlagenbau Chemnitz.
Bierbrücke (1869 erneuert): Zufahrt zu den im Kaßberghang gelegenen Bierkellern, die den Bürgern mit Brauberechtigung zur Reifung der „stark gehopften Lagerbiere“ ab dem 16.Jh. bis 1778 dienten.
Markthalle, An der Markthalle: Nach Plänen des Stadtbaurates Hechler im Stil des Historismus mit Elementen des NeoBarock erbaut und 1891 eröffnet. Berühmtes Vorbild ist die Pariser Markthalle u. bot 350 Ständen Platz.
Das Kunstwerk 7 magere und 7 fette Jahre von Ralph Siebenborn (*1998) zu je 7 Metallsäulen. 7 mageren Jahre am südEingang der Markthalle (an Bierbrücke). Am Nordausgang (Seeberplatz) das Gegenstück: 7 fetten Jahre.
Guido-Seeber-Platz: So wie viele überregional bekannte Theater- und Filmschaffende ihre Laufbahn in Chemnitz und Karl-Marx-Stadt begannen, so kann eingebettet von der historischen Markhallen-Kulisse der Seeberplatz in Vertretung für diese medial berühmten Söhne und Töchter der Stadt dienen, die Literatur, Musik und Künste vermittelnd darboten, um den Gehalt von Leben aus der Fiktion heraus darzustellen. Namensgeber ist die Chemnitzer Familie Seeber-Vater Clemens, ein namhafter Fotograf, und Sohn Guido, ein deutscher Filmpionier u. Begründer der Filmstadt Babelsberg > siehe auch R.Tauber (Oper) u. Ulrich Mühe, Hartwig Albiro (DDR-1992), Rolf Stiska (1992-2006 Intendanz), Dramaturg Heiner Müller (gb. in Eppendorf bei Chtz.), Sebastian Schweighöfer, Nancy Gibson, Jörg Schüttauf (*1961 K.-M.-St., u.a. Tatort, wie Eberhard Feik 1943-94, Partner v. Kommissar Schimanski), Rio Reiser u.a. am Schauspiel C
Hedwig-Hof / Passage Feministische Autorinnen der Stadt wie Irmtraud Morgner werden vorgestellt, u.a. Irmtraud Morgner oder das Wortgut-Projekt der Lila Villa. Vorstellung von einfacher und leichter Sprache im Vergleich!
Blick zur Hartmannfabrik: Mit 23 Jahren kam Richard Hartmann mit nur 2 Talern in der Tasche aus dem Elsass nach Chtz. u. machte Karriere bei Carl Gottlieb Haubold im Werkzeugmaschinenbau, 1837 gründete er seine eigene Fa., die Sä. Maschinenfabrik R. Hartmann. 1848 baute er die 1. Dampflok in Chemnitz. Wg. Sächs. Eisenbahnkrieges wurden die DampfLoks mit 30 Pferden regelmäßig bis 1908 durch die Stadt gezogen > Kulturhauptstadt - Welcome Center m. Leih-Skulpturen von der Baseler Kunstmesse des Mäzen Pfeiffer (Logistiker Getränke): Van Lieshout „Geier“ / Tatjana Doll „Das Licht am Ende des Tunnels ist das Licht der Lok, die mir entgegenkommt“ / Franka Hörnschemeyer „Equation“ / Heike Mutter „Schlaf. Pferd“ / Lydia Thomas „Gravitation (Cyberfaun & Guardian)“
FUN-FACT: alles rund um den Hartmanplatz erinnert an den Chemnitzer Eisenbahnkrieger Richard Hartmann: Hartmannfabrik, Hartmann-Allzweckhalle, Hartmann-Oberschule, Hartmann-Berufsschule, Villa Hartmann, Hartmannstr. m. Polizeipräsidium (ehem. Verwaltungsgebäude der Sä. Maschinenfabrik R.Hartmann) - Apropos Eisenbahnkrieg: war eher ein stadtinterner Zwist zwischen den Unternehmern Schönherr (Sittz zw. Schloßteich und Küchwald) und Hartmann, da Schönherr des Hartmanns Lokomotiven nicht über seine Gleise mit Anschluss nach Leipzig fahren ließ, welshalb Hartmann mit 30 Pferden jede Lok zum Hauptbahnhof karren musste, bis er einen Trassenanschluss durch den Güterbahnhof Altendorf erhielt.
vor dem Luxor-Palast (ehem. Großkino m. Puppentheater) die "Faust" von Rolf Magerkort - war der Sammlungsort der Kräfte der politischen Wende nach 40 Jahren DDR im Herbst 1989.
Die Pinguinkolonie von Peter Kallfels steht seit dem 26.11.2004 in der Inneren Klosterstraße.
Die bronzene Skulpturengruppe besteht aus 14 Kaiserpinguinen. FUN-FACT: auf dem Boden sind Umrisse der Antarktis und der Stadt Chemnitz u.a. rot aufgebracht, denn die Umrisse der Stadt ähneln denen der Antarktis (eine Landzunge des Ortsteils Grüna im Westen der Stadt vergleiche man mit der Antarktischen Halbinsel, die sich gen Südamerika neigt! Verfolgt man jene bei Güna nördlich bis Penig so stößt man unweigerlich auch auf eine Gemarkung "Amerika"). Zudem ist der Längengrad 12°55´11" östlicher Länge eingezeichnet. FUN-FACT: dieser verläuft über die Innere Klosterstraße zum Südpol und trifft dort in 15.000 km Entfernung auf eine der größten Kolonien von Kaiserpinguinen.
SKULPTURENGARTEN im Hof der Volksbank (alle Skulpturen Dauerleihgaben der Neuen Sächsischen Galerie):
"Erde" und "Pause" von Fritz Böhme bestehen aus Muschelkalk (1979 u. 1982), "Venus" (1986) von Stephan Möller aus Sandstein, "Vita" (1974) Betonplastik von Gerd Jaeger (1974) sollte im Oktober 1981 auf dem Fußgängerboulevard hinter dem ehemaligen Flughafengelände aufgestellt werden, "Windrose" Die Skulptur von Armin Forbrig besteht aus griechischem Kalkstein (1998), "Elefantengruppe" befindet sich in der Inneren Klosterstraße, nahe dem Skulpturengarten, zu dem sie jedoch nicht gehört. Herkunft u. Künstler sind nicht bekannt.
Carlowitz-Congress-Center (Carl v. Carlowitz´“Sylvicultura“→ Begriffsprägung Nachhaltigkeit
Kultur und Kultivierung im Botanischen Bereich sind auf ästhetischem Terrain miteinander verwoben. Der Rabensteiner Bürger Hans Carl von Carlowitz präfgte zudem den Begriff der Nachhaltigkeit, der heutzutage inflationär verwendet wird. Daraus ergibt sich ein Diskussionsansatz der Sparte Risikokommunikation (auf die am Spot 8 nochmal zurückgegriffen wird), der mittels einer Podiumsrunde im Vulcano-Auditorium der ehem. Kleinen Stadthalle, jetzt Carlowitz Congress-Center. 1974 eröffnete die Stadthalle, die Chefarchitekt Rudolf Weißer als moderne Mehrzweckhalle mit einem Hotelhochhaus von herausragender Architektur und Funktionalität entwarf.
Stadtbad, Meisterwerk des „Neuen Bauens“ ist ein Entwurf des Stadtbaurates Fred Otto. Zur Eröffnung 1935 galt es als „schönstes und größtes Hallenbad Europas“. Die Hochwasser 2002, 2010 und 2013 hinterließen ihre Spuren, wodurch das Bad mehrfach saniert werden musste. Die zweiteilige Bronzeplastik Paar von Harald Stephan (1983) - sie ist ein Neuentwurf von Heinrich Brenners Paar. Dessen Skulpturen wurden während des zweiten Weltkriegs zerstört. Die vierteile Figurengruppe Wassergetier (1935) Bronze von Bruno Ziegler an den Fahnenmastsockeln vor Stadtbad Mühlenstr. zeigt Gänse, Biber, Otter, Haubentaucher.
Blick auf HeckArt (Exkurs Wohnungsbau Fritz-Heckert-Gebiet) und in der Ferne... Daniel Burens „7 Farben für einen Schornstein" / Langer Lulatsch / Ringelriese / Schorsch hat die alphabetische Anordnung der Farben von unten nach oben vorgegeben: „Aquamarin“ auf dem untersten Abschnitt bis 40 Meter Höhe, dann „Erdbeerrot“ (bis 70 Meter), „Gelbgrün“ (bis 120 Meter), „Himmelblau“ (bis 165 Meter), „Melonengelb“ (bis 210 Meter) und „Signalviolett“ (bis 255 Meter) und „Verkehrsgelb“ (bis 302 m)
Blick in die Brückenstr. Mit dem denkmalgeschützten Ensemble der sog. „Ostmoderne“ zwischen der ehem. „Parteisäge“ bzw. "Parteifalte" über die Stadthalle mit Hotel und den Bauten der Straße der Nationen (StraNa) rund um das Karl-Marx-Monument (sächs. "Nischl"), eine über 7 m hohe und ca. 40 Tonnen schwere Bronzebürste, 1971 vom sowjetischen "Lenin"-Bildhauer Lew Kerbel geschaffen. 37 Jahre war die Stadt auf Karl-Marx-Stadt umbenannt worden. Neben einem Lenin-Monument in Ulan-Ude zählte dieses lange als größte Portraitbüste der Welt.
Bei diesem Spot stehen Sprache und Rhetorik der Arbeiterkultur im Fokus.
Mit einer Volksausgabe des Marx´schen "Kapital", welche Johann Most in einem Chemnitzer Verlag 1872 erstmals herausgab und 1876 in einer 2. Auflage von Karl Marx selbst redigiert/überarbeitet wurde ist das monumentale Denkmal quasi wie ein verlegerisches Andenken (FUN-FACT!), denn beide Schriften in einfacher Sprache und Auslegung erschienen im Privatverlag und -vertrieb in Chemnitz, auch wenn Marx in Chemnitz nie nachweislich weilte.
Es handelt sich hierbei um das 100 Seiten starke Bändchen "Kapital und Arbeit", quasi eine Einführung in den Wälzer „Das Kapital“ von Karl Marx - er korrigierte bewusst Verständnisfehler und tauschte Passagen sogar aus.
[ Quellen: Most´s
"Kapital und Arbeit" - ältere Suhrkamp-Ausgabe mit Anhang,
http://www.stadtbibliothek-chemnitz.de/autorenlexikon/pmwiki.php?n=Autor.JohannMost ]
KURIOS: beim Aufbau des Bronzekolosses, der aus 95 Teilen besteht und in Leningrad gegossen wurde, kam es zum tragischen Tod des Transportarbeiters Hubert Krause, der angeblich schon vormittags eine halbe Flasche Goldbrand und mehr als einen Liter Bier intus hatte. Der Unfall wurde schnell vertuscht, damit Westmedien keine negativen Schlagzeilen veröffentlichen konnten zur feierlichen Einweihung.
Skulpturen-Ensemble „Fünf Lobgedichte“ mit Texten von Bertold Brecht ein markantes literarisches Denkmal an die Zeit des Sozialismus und der damit verbundenen Auf- und Umbrüche in der Stadt. Am 6.10.1972 wurde dieses Ensemble fertig gestellt. Es besteht aus drei Reliefwänden und einer Stele. In ihr wurde Brechts 5 Lobgedichten gehuldigt. Martin Wetzel gestaltete das Relief Lob der Partei und die Stele Lob des Kommunismus. E.Roßdeutscher schuf Lob des Revolutionärs (vierteilig). Joachim Jastram setzte die Gedichte Lob des Lernens und Lob der Dialektik in einem Relief um.
Im Gedenken an den Chemnitzer Märtyrer und Bildhauer der DDR-Zeit Johannes Belz: „Kampf und Sieg der revolutionären deutschen Arbeiterklasse“ - eine monumentales bronzenes Wandrelief am Gebäude der Edeka-Gruppe ggü. SMAC in unmittelbarer Nähe zu den Plastiken der Lobgedichte (Mäzen der nun priv. Plastik ist Investor Mierbach), vergleichbar mir jenem Großrelief an der ehem. Karl-Marx-Uni. Leipzig am Augustusplatz.
Blick zum Friedensplatz: ehemals im Innenhof der Schmidtbankpassage, Ecke Hartmannstraße (dort seit 1997), steht die Stahlskulptur Reliquie Mensch (auch "Aufsteigender" genannt) von Michael Morgner nun vor dem Techn. Rathaus. Mit dem Grundthema “Ecce Homo” beschäftigt sich Morgner seit 1984, mit “Reliquie Mensch” speziell seit 1994. Eine Realisierung des Themas “Reliquie Mensch” in plastischer Form war zunächst als Mahnmal an die Bombardierung von Chemnitz (1945) gedacht.
Blick zum SMAC Während im Sächsischen Museum für Archäologie Chemnitz (SMAC, seit 2014) in der 3. Etage ein Ausstellungsteil frühe Exponate zur älteren Schrift- und Schreibkultur und Buchdrucke aus Mitteldeutschland zeigt, kann man zudem in der Fenstergalerie des ehem. Kaufhauses „Schocken“ (1930 nach Entwürfen von Erich Mendelsohn mit konvex gekrümmter Betonvorhangfassade errichtet) die Verlagsgeschichte des gleichnamigen weltbekannten Verlages „Schocken Books“ studieren.
Saxonia-Brunnen (Texte zu Heimatdichtern Theodor Körner & Anton Günther)
Roter Turm ältestes Wahrzeichen der Stadt, entstand im 12. Jh. und diente als Bergfried, Stadtvogtei, Verlies und Teil der Stadtbefestigung, KURIOS: Karl Stülpner & August Bebel saßen hier ein (und der Marx schaut viele Jahre stets grimmig auf dieses ehem. Gefängnis
Die Skulptur Ginkgo steht vor dem Roten Turm und wurde dort im Rahmen des Kulturprojektes InSicht 2001 aufgestellt. Das mit einer rostigen Metallpatina überzogene Ginkgoblatt wird auch Baumskulptur (R.Ph.Bruhn) genannt.
Der Rote Turm verkörpert den typischen Bergfried. Seit Bestehen der Stadt Chemnitz war er in die Stadtbefestigung einbezogen. Im Zuge der Landesbesiedlung während der feudalen dt. Ostexpansion entstanden etwa 1125-1135 im späteren Stadtgebiet von Chemnitz mehrere Dörfer und ein Herrensitz mit Dienstsiedlung, der einem Vasallen des Kgs. zur Gebietsverwaltung anvertraut war. Noch am Anfang des 13. Jahrhunderts war dieser Sitz Hof des Richolf genannt. In dessen Nähe gelegene Grundstücke hießen noch weit bis ins 16. Jahrhundert hinein „Hofereite“ bzw. „Herrengasse“, u. endeten in einem (Wiesen-)“Plan“. Etwa im 4. Jahrzehnt des 12. Jh., wohl vom 1127 gegr. Benediktinerklosters ging der Hof in die Verwaltung des für das Kloster zuständigen weltlichen Vogts, Markgraf Konrad von Meißen, über. Die Vogtei, von einem Vertrauten Konrads ausgeübt, bediente sich der Blutgerichtsbarkeit.
Im Stadthallenpark, in der Nähe des Roten Turms, steht u.a. der Neeberger Torso von Wieland Förster (1974) und „Würde, Schönheit und Stolz“, „Sinnende“, „Produktivkraft“.
Im Großen Saal der Stadthalle ist die Figur des Galileo Galilei auf Grundlage von Bertolt Brechts Drama Das Leben des Galilei (Fritz Cremer), auch „Und sie bewegt sich doch!“, zu entdecken. Besonderheit ist die Kugel, die Galilei in der Hand hält, da sie sich, angetrieben durch einen Motor, um sich selbst drehen kann, 1974 enthüllt.
Rathaus (siehe Info-Stele direkt vor dem Alten Rathaus) & Siegertsches Haus im spätbarocken Stil v. Ende 18.Jh., neues Rathaus 1910 im Jugendstil mit Kunstwerken v. Max Klinger u. Carillon-Spiel (1978) u. 5m hohem Roland / Hoher Turm war v. 12.-14.Jh. Sitz des Vogtes, barocker Umbau 1746, Sitz des Türmers.
EXKURS Park der Opfer des Faschismus (OdF):
Johanniskarree von Investor Simmel zwei neuerrichtete Baufelder m. Spielplatz und bepflanzter Zwischenetage
Die Mikwe: bei den Vorbereitungen zum neuen Johanniskarree entdeckten die Archäologen Anfang 2022 ein jüdisches Tauchbad („Mikwe“ für rituelle Waschungen), befand sich einst im Keller eines Hauses am Gablenzbach - bestand aus einem Vorraum zum Auskleiden und dem Becken, in dem man untertauchte (Glaubensakt kultischer Reinheit). Es ist die einzige Mikwe aus dem MA od. der Frühen Neuzeit, die in Sachsen gefunden wurde. Rätsel: Juden war zw. 1430 bis frühem 19. Jh. keine Ansiedlung in Sachsen erlaubt! Vielleicht war sie gedacht für die zahlreichen jüdischen Kaufleute aus Böhmen und Österreich, die bei ihrer Reise zur Leipziger Messe und entlang der "Salzstraße" des europäischen Handels durch Chemnitz zogen, ggf. auch für jüdische Unternehmer, die sich mit Sondererlaubnis niederlassen durften.
ehem. Schauspielhaus an der Zieschestr., Neubau seit 1980, vorher 1945-76 Theater im Festsaal des Altenheimes nebenan (da im Krieg die Spielstätte in der Theaterstr. ausgebombt wurde), der einem Brand zum Opfer fiel, 2002 modernisiert, jetzt leerstehend (Interim ist an der Altchemnitzer Str. im Spinnbau), obwohl es im Bitbook der Kulturhauptstadt zur Interimsfläche erkoren wurde, jedoch die Sanierung sich auf einen fünfstelligen Millionenbetrag erhöhen würde, wenn das Theater den neuesten Standards und Normen angepasst werden würde.
Allee des Lichts: Verbindungsweg zwischen Schauspielhaus und Stadtzentrum,
Weg von 630 m Länge, vier ovale Plätze mit Sitzgelegenheiten, 24 Laternen, die von den 12 Chemnitzer Partnerstädten geschenkt wurden, Fertigstellung April 2011 - Partnerstädte von Chemnitz mit ihrer Stadtbeleuchtung:
Akron (USA), Arras + Mulhouse(Frankr.), Düsseldorf (D), Ljubljana (Slowenien), Manchester (GB), Taiyuan (China), Tampere (Finnl.), Timbuktu (Mali), Usti n.L.(CZ), Lodz (Polen)
Verwaltung der Wasserwerke: eines der ersten Gebäuder der Neuen Sachlichkeit in Chtz. (angelehnt an den Vorgängerbau Glockenstr./ Nähe Hbf. - ehem. Lagerhaus der Fa. Emden & Söhne d. Hamburger Architekte Gerson), angepasster Klinkerbau dem gekrümmten Straßenverlauf folgend, den Haupteingang krönt ein Keramikstadtwappen
Industrieschule: 1925 hatte Chemnitz ca. 9000 Berufsschüler und steigenden Bedarf an Schulen durch Stadtwachstum. Einen Bauwettbewerb mit 142 Teilnehmern gewann Friedrich Wagner-Poltrock. Am 15.10.1928 wurde die damals größte und modernste Berufsschule Deutschlands eingeweiht. Der auffällige rote Klinkerbau mit Stilelementen des Art déco trägt die Fassadenplastik „Der gefesselte Deutsche“ von Heinrich Brenner
Friedrich-Wagner-Poltrock (1883-1961), bis 1925 Chemnitzer Baustadtrat, anschließend freiberuflicher Architekt, 1952 Übersiedlung ins Rheinland, Weitere Werke in Chtz.: Diesterwegschule, Umspannwerk am Getreidemarkt (jetzt JH)
Mahnmal für die Opfer des Faschismus: 1952 vom Bildhauer Hanns Diettrich aus Rochlitzer Porphyr und Sandstein geschaffen, ...für die Opfer der NS-Diktatur, plastische Szenen (Peinigung und Befreiung), Inschriften auf Vorder- und Rückseite, jährlich am 27. Januar Kranzniederlegungen, Hanns Diettrich (1905-83), war Schüler von Gerhard Marcks und Martha Schrag, stand revolutionären Künstlervereinigungen nahe und schuf Bildnisse v. der Würde des Menschen, Weitere Werke in Chemnitz: Brunnen „Spielende Kinder“, Straße der Nationen, 1965,
Ernst-Thälmann-Büste am Schloßteich, 1966, „Augustkämpfer“ am Bahnhofsvorplatz, 1977
Georgius-Agricola-Gymnasium: Der rote Klinkerbau im Stil der klassischen Moderne wurde am 20.04.1929 eingeweiht als Realgymnasium am Alten Johannisfriedhof. Der Architekt war Emil Ebert (1859-1945) als Gewinner eines 1914 von der Stadt ausgeschriebenen Wettbewerbs.
Auffällige Details: Portal und Türgestaltungen im Inneren von Bruno Ziegler (1879-1941),
Jünglingsfiguren an der Fassade von Heinrich Brenner (1883-1960) – restauriert v. Erik Neukir.,
Sternwartenkuppel mit Wirkung eines Dachreiters,
Treppengestaltung im Inneren von Kurt Feuerriegel (1880-1961),
Aula mit Buntglasfenstern von Alfred Bielenberg und Jehmlich-Orgel (1883-1941),
Heute ist das Gymnasium nach dem Universitätsgelehrten Georgius Agricola benannt, der um 1550 Bürgermeister von Chemnitz war. Irmtraud Morgner ging hier zur Schule (Feminist. FrauenOrt !)
Marx-Engels-Denkmal: Bronze (1957), 1965 am jetzigen Standort aufgestellt, 1959 dafür den Kunstpreis der DDR erhalten, Fun-Fact: Weltweit gilt es als erstes Denkmal, das die beiden als Freunde darstellt. Walter Howard (1910Jena - 2005 Moritzburg), 1946 Studium der Bildhauerei an der Hochschule für bildende und angewandte Kunst Berlin, Assistent und Dozent an der Hochschule Berlin-Weißensee, 1961 Lehrer an der TU-DD (1963 Prof.)
SKULPTUREN im Park der O.d.F.:
Liebesnest Bronzeskulptur von Volker Beier, geschaffen 1978, aufgestellt 1980, Beier (1943-2023 Chemnitzer), nach einer Steinmetzausbildung besuchte er die Fachschule für angewandte Kunst Leipzig, später war er Meisterschüler an den Akademien der Künste in Moskau und Berlin und Mitglied von Künstlerverbänden, Weitere Werke in Chemnitz: Agricola-Säule an der Treppe neben dem ehem. Stadtwerkehaus, 1994, Gedenkstele für die zerstörte Synagoge am Stephansplatz (1988), Schriftfeld „Proletarier aller Länder vereinigt Euch“, hinterm Nischl, Brückenstr. 1971 (mit Heinz Schumann)
Die Sinnende Bronzeskulptur der Bildhauerin Sabina Grzimek, fertig gestellt 1977, aufgestellt 1980,
Zunächst stand sie im Rahmen der Ausstellungsserie „Plastiken im Freien“ im Stadthallenpark. Im Innenhof der Berliner Humboldt Universität steht ebenfalls eine Sinnende. Grzimek (*1942 in Rom), 1961 einjähriges praktisches Jahr an der Porzellan-Manufaktur in Meißen, anschließend 5 Jahre Bildhauerstudium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, freischaffend tätig seit 1997 Gastdozentin an der Grafik- und Design-Schule in Anklam.
Ringende Bronzeskulptur des Bildhauers und Malers Siegfried Krepp, 1980 vor dem Schauspielhaus,
Siegfried Krepp (1930-2013), 1945 Lehre zum Verwaltungsgehilfen, danach 2-jährige Umschulung zum Maschinenschlosser, 1950 Arbeit als Dekorateur, 1952 Beginn des Studiums an der Hochschule für bildende und angewandte Kunst in Berlin, 1978 bis 1981 Lehrauftrag dort
Tänzerin Bronzeplastik von Gerhard Lichtenfeld (1965), aufgestellt 1980, auch unter dem Namen „Tanzendes Mädchen“ bekannt. Lichtenfeld (1921-78 aus Halle), 1942 Studium der Rechtswissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle, 1946 Studium am Institut für künstlerische Werkgestaltung Burg Giebichenstein, später Tätigkeit an der Kunstakademie München, Arbeiten von ihm unter anderem in Kairo, Moskau, Neu-Delhi
Die Lauschenden Sandsteinskulptur von Peter Fritzsche, 1980 geschaffen und aufgestellt,
Peter Fritzsche (1938-2022), Lehre zum Steinbildhauer, 1955 bis 1958 im VEB Elbenaturstein Dresden tätig, später Studium an der Hochschule für bildende Künste in Dresden, ab 1964 freischaffend tätig, zuletzt in Freital, weitere Skulpturen in Chemnitz: Hochzeitsbrunnen, Str. d. Nationen, 1984
Die Idee Steinskulptur von Fritz Böhme, aufgestellt 1980, sie wird auch als „Versuch des Menschen“ bezeichnet.
Fritz Böhme (1948 GC - 2013 Hohndorf), absolvierte 1976 eine Steinmetz- und Steinbildhauerlehre, ab 1976 Mitglied im Verband Bildender Künstler der DDR, arbeitete zuletzt freischaffend als Restaurator in der Nähe von Zschopau,
Weitere Werke in Chemnitz: die Skulpturen Erde (1979) und Pause (1982) im Skulpturengarten Volksbank, Klosterstr.
Villa Zimmermann (1865-67) als Massivbau nach Plänen des Hamburger Architekten Otto Goetze im Tudor-Stil errichtet. Bauherr war der Fabrikant Johann von Zimmermann, der Begründer des deutschen Werkzeugmaschinenbaus. Das Gebäude zählt zu den wertvollsten Baudenkmälern der neugotischen Wohnhausarchitektur des 19. Jahrhunderts in Sachsen – nun wird es zum Bürohaus
[ was sonst noch so zu entdecken ist, kann man bei ChemNetz von der Bordsteinlobby erSTAUNen ! ]
KulTOURwerk Chemnitz beteiligt sich am Kunstprojekt "THE CHEMNITZ PAVILION: City of Stickers" / Concerving my Luck (01.02.2023 - Kulturhauptstadt News)
... The Chemnitz Pavilion is a sticker book & a guidebook and is open to all, celebrates Chemnitz as a CITY OF STICKERS, ...a participatory project that invites residents and visitors to produce a sticker & select a site in Chemnitz that has inspired you to dream, play, create... In other words, a space, object, environment, park, building, street or... in Chemnitz that has inspired your imagination, ...in responsing & documenting in context of the site: on a wall, bench, post, building... presented at the Venice Biennale 2024
kontakt [at] lesewelt.info // 0371-641166 / Fax -6761832 oder via..